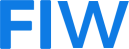58. Innsbrucker Symposion des FIW – 05.03. bis 07.03.2025
Das Innsbrucker Symposion des FIW bot zum 58. Mal führenden Vertretern der Wirtschaft, Anwaltschaft, Verwaltung und Justiz ein Forum über Fragen der Wirtschaftsverfassung und der Wettbewerbspolitik. Zur Einstimmung auf die Tagung fand am ersten Abend ein Empfang durch die Wirtschaftskammer Österreich – Tirol – statt.
Donnerstag – 06.03.2025
Jan-Peter Horn, der Vorsitzende des FIW e. V., begrüßte die Teilnehmer. Er wies auf den ordnungspolitischen Kurs des FIW hin. Das FIW habe eine wichtige Rolle, auf die Spielregeln einer freien Marktwirtschaft hinzuweisen und Überzeugungsarbeit zu leisten. Der Staat solle nur den gesetzlichen Rahmen setzen und dessen Einhaltung überwachen. Ansonsten solle er sich heraushalten. Die soziale Marktwirtschaft setze als Grundlage für wirtschaftlichen Wohlstand auf Wettbewerb; dieser schaffe Innovation und Wohlstand. Dabei seien alle Gewinner, weil die Volkwirtschaft vom Wettbewerb um Innovationen „lebe“. Horn monierte, dass zuletzt zunehmend das Vertrauen in den Wettbewerb gefehlt habe. Der Wettbewerb sei Grundpfeiler der Wirtschaftsordnung und müsse aktiv geschützt werden. Die Märkte veränderten sich derzeit stark in Zeiten der Dekarbonisierung, Digitalisierung, Demographie, De-Risking, De-Globalisierung und der Demokratiegefährdung. Die Verschuldungsszenarien der kommenden Regierung könnte auch Auswirkungen auf den Wettbewerb haben. Die Unternehmen, gerade auch der Mittelstand (95 Prozent aller Unternehmen), stünden unter wachsendem Druck. Das Kartellrecht benötige eine Balance zwischen Regulierung und Wettbewerbsfähigkeit. Horn ließ einige Entwicklungen und Anliegen der Wirtschaft im Wettbewerbsrecht der letzten Zeit Revue passieren. Um global wettbewerbsfähig zu sein, müssten Innovation und langfristige Marktchancen berücksichtigt werden. Die Wettbewerbspolitik müsse es auch ermöglichen, dass Unternehmen im internationalen Umfeld erfolgreich seien. Aus diesem Grund dürften EU-Unternehmen nicht übermäßig reguliert werden, damit sie – global betrachtet – nicht ins Hintertreffen gerieten.
Andreas MUNDT: Aktuelle Herausforderungen in der Wettbewerbspolitik (vgl. separaten Bericht dazu 58. FIW-Symposion – Andreas Mundt zu „Aktuellen Herausforderungen in der Wettbewerbspolitik“ – FIW Forschungsinstitut für Wirtschaftsverfassung)
Dr. Thorsten KÄSEBERG (BMWK): Aktuelle Entwicklungen in der Wettbewerbspolitik – national und europäisch
Käseberg betonte, dass die Wettbewerbsfähigkeit und die Industriepolitik in Europa derzeit die erste Priorität einnähmen. Er habe die Hoffnung, dass vom „Competitiveness Compass“ der EU-Kommission viel umgesetzt werde. Die Zeit der Papiere sei vorbei. Die EU-Kommission und die neue Bundesregierung müssten „liefern“. Auch im Bereich der Fiskalunion müsse man sich bewegen. Andererseits sollte die vertikale Industriepolitik besser kontrolliert werden. Es gelte, die Förderungen durch die Mitgliedstaaten, die auch weiter überwiegend aus nationalen Töpfen fließen werden, besser einzuhegen, indem bei den Förderprogrammen eine Priorisierung erfolgen solle. Es sollte auch überlegt werden, die Trennung von ziviler und militärischer Forschung aufzuheben.
Auch sei mehr Rechtssicherheit für Kooperationen wichtig. Die EU müsse im transatlantischen Verhältnis die Regeln durchsetzen (Beispiel: Digital Markets Act). Es gehe dabei nicht nur um das Kartellrecht, sondern auch um den Rechtsstaat und das Demokratieverständnis. Bei den anstehenden Entwicklungen in der Wettbewerbspolitik müsse § 19a GWB demnächst auf gesetzlicher Grundlage evaluiert werden. Nötig sei auch ein „Update“ des DMA, der aktuell ein Defizit bei Künstlicher Intelligenz aufweise. In dem Bereich gebe es eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich und den Niederlanden und ein Bestreben, Cloud-Dienstleitungen unter dem DMA zu designieren und Künstliche Intelligenz als „stand alone“- Kernplattformdienst aufzunehmen. Außerdem sollten die DMA -Verpflichtungen über das Instrument der Marktuntersuchung aktualisiert werden.
Die durch die Rechtssache Illumina/Grail entstandene Durchsetzungslücke in der Fusionskontrolle sollte nicht durch sog. Call-In-Rechte geschlossen werden. Besser sei es, Transaktionswertschwellen auch in anderen Mitgliedstaaten vorzusehen. Die Umsatzschwellen der EU-Fusionskontrolle sollten nach 20 Jahren angehoben werden, um die Spielräume für die Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit zu erhöhen. Käseberg schätzte die Wahrscheinlichkeit einer Überarbeitung der Fusionskontrolle dennoch als gering ein. Zuletzt sprach er über die – größtenteils bekannten – Kernelemente der 20. Legislaturperiode avisierten 12. GWB-Novelle („GWB-Maßnahmenpaket“), über die man weiter diskutieren sollte.
Dr. Armin JUNGBLUTH, (Bundesministerium für Digitales und Verkehr):
35 Jahre Wettbewerbspolitik – Kontinuität und Wandel
Jungbluth gab einen launigen, informativen Überblick über seine beruflichen Aufgaben und Betätigungsfelder in der Wettbewerbspolitik über die letzten 35 Jahre, beginnend mit seinem Start im Jahr 1989 im Wettbewerbsreferat des damaligen BMWi und der 5. GWB-Novelle sowie der Ministererlaubnis Daimler/MBB und den Verhandlungen über eine EU-Fusionskontrolle. Über 95 Prozent der Themen seien bis heute gleich geblieben, so Jungbluth. Immer wieder habe sich auch die Frage nach einem europäischen Kartellamt gestellt
Neben weiteren Ministererlaubnissen (MAN/Sulzer, Daimler-Benz/MAN/ENASA) sei es 1990 im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung um die Umwandlung der staatlichen Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft und um die Frage gegangen, wie man die ungeordnete Übernahme der monopolistischen Staatsunternehmen durch andere Unternehmen verhindern könne. Jungbluth ließ weitere GWB-Novellen (6./7. GWB-Novelle) und Ministererlaubnisse Revue passieren. Der Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Brüderle eines Entflechtungsgesetzes habe 2009 für Furore gesorgt und sei an ordnungspolitischen und verfassungsrechtlichen Bedenken seitens des BDI und Prof. Stefan Thomas im ersten Anlauf gescheitert. Vielleicht sei der neue § 32 f GWB jetzt klarer konturiert, gab Jungbluth an. Mit der 8. GWB-Novelle (2013) habe das GWB keine Anwendung mehr auf die Wassergebühren gefunden. Beim Bundeskartellamt sei wegen hoher Spritpreise eine Marktransparenzstelle eingerichtet worden. Auf EU-Ebene sei die Kartellschadensersatz-Richtlinie verabschiedet worden. 2015/2016 habe Jungbluth die 9. GWB-Novelle, mit der u. a. die „Wurstlücke“ und die Konzernmutterhaftung eingeführt worden sei, und die Edeka /Tengelmann- Ministererlaubnis beschäftigt. Danach sei eine Diskussion über eine Einbindung des Bundestags beim Ministererlaubnisverfahren geführt worden. Jungbluth schloss seinen Vortrag mit den EU-Bestrebungen, mit dem Digital Markets Act (DMA) und dem Digital Services Act (DSA) eine Plattformregulierung einzuführen und verwies auf die aktuellen Ansinnen der Trump-Administration, wonach der DMA und der DSA auf den Prüfstand gehörten (vgl. dazu auch FIW-Bericht vom 26.02.25 – U.S.-Präsident: Digital Markets Act und andere EU-Digitalgesetze gehören auf den Prüfstand – FIW Forschungsinstitut für Wirtschaftsverfassung)
Dr. Christoph MÜLLER Geschäftsführung, Amprion GmbH: Transformation in der Energiewirtschaft – politische Stabilität für dynamischen Wettbewerb
Im traditionellen „Unternehmervortrag“ stellte Müller die Amprion GmbH als privatwirtschaftlich organisierten und unter vieren führenden Netzbetreiber vor, der Stromautobahnen von NRW bis zum Bodensee betreibe und 30 Mio. Bundesbürger versorge. Müller zufolge sei der Ausbau der Infrastruktur eine Voraussetzung für die Transformation des Energiesystems und für Wettbewerb. Er berichtete über aktuelle Projekte, z. B. Bau- und Projektierungsprojekten über Strecken von 400 km, und wie der Strommarkt seiner Meinung nach derzeit funktioniere. Die Energiewirtschaft sei über Jahrzehnte ein Hort der Stabilität gewesen. Seit der Liberalisierung und Öffnung des Strommarkts hätten die Märkte sich entwickelt, und Strombörsen seien entstanden. 27 Jahre später sei festzustellen, dass nur ein funktionierender Strommarkt aus sich selbst heraus Kapazitäten generiere. Im aktuellen Strommarkt gebe es noch immer alte Kraftwerke aus der alten Ära, die auf Subventionen aus dem EEG basierten. Ein Wiedereinstieg in die Kernenergie sei angesichts eines fehlenden gesellschaftlichen Konsenses unrealistisch („erst, wenn auch die Grünen dafür seien“). Nach Meinung Müllers funktioniere der Markt, auch wenn die Politik und die Gesellschaft mit dem Energiemarkt fremdelten; in der Politik und Gesellschaft fehle ein Verständnis für diesen komplexen Markt. Marktoptimierung und Versorgungssicherheit seien jedenfalls durch Export und Import aus und in die EU-Länder gesichert.
Müller plädierte für eine grundlegende Netzentgeltreform. Die Netzentgelte, die daran krankten, dass die Verursachergerechtigkeit verloren gegangen sei, hätten im Kern die Funktion, das Netz zu finanzieren. Benötigt würden auch eine Reservekraftwerksstrategie und ein gesamtgesellschaftlicher Energievertrag, mit dem das Zusammenspiel von Gesellschaft und Politik geklärt und mit dem eine nachhaltige Ausrichtung geschaffen werde, die mehrere Legislaturen überdauern könne und parteiübergreifend getragen werde. Klimaneutralität und Wohlstand seien keine Gegensätze. Am Kernenergieausstieg solle festgehalten werden bei Gewährleistung von Technologieoffenheit und Innovationen. Auch sei eine gemeinsame europäische Politik vonnöten.
Podiumsdiskussion: Transformation durch Wettbewerb oder Industriepolitik?
Dr. Christoph MÜLLER Geschäftsführung, Amprion GmbH
Professor Dr. Marc Oliver BETTZÜGE, Universität zu Köln (EWI), Köln
Professor Dr. Georg GÖTZ, Justus-Liebig-Universität, Gießen
Dr. Carsten ROLLE, Bundesverband der deutschen Industrie, Berlin
Auf dem anschließenden Panel wurden von Müller einige bereits im Unternehmervortrag angesprochenen Themenkomplexe in der Diskussion vertieft. Bettzüge zeichnete von Deutschland ein pessimistisches Bild. Deutschland sei nicht die wachstumsstärkste Nation, gerade nur etwas stärker als die Russische Föderation. Seit 2009 treffe Deutschland eine De-Globalisierungswelle; Deutschland sei bei den Energierohstoffen zu 70 Prozent importabhängig und habe den höchsten Preis für CO2-Emissionen. Die Transformation werde noch teurer als der Emissionshandel. Deutschland habe zusätzliche Nachteile bei den Stromkosten (z.B. hoher EE-Anteil). Ein Gegensteuern durch Industriepolitik (Einführung von CO2-Preisen und Unterstützung bestimmter Industrien durch Emissionszertifikate) sei aber nicht konsequent. Der CO2-Preis sei zwar grundsätzlich effizient, führe aber v.a. zu Strukturwandel und der Reduktion von Aktivitäten. Zur Korrektur müsse dann der Staat aktiv eingreifen. Es bestünden Zweifel, ob Deutschland dauerhaft die Differenzkosten finanzieren könne. Strom würde eher teurer als günstiger (keine Strom-Flat-Rate in Sicht).
Götz wies darauf hin, dass in den letzten 20 Jahren alle marktwirtschaftlichen Elemente aus dem Strompreis vernichtet worden seien. Die Abschaltung der Kernkraftwerke habe die Verbraucher 8 Mill. EUR extra gekostet. Somit seien wesentliche Kosten externalisiert worden. Der EU-Binnenmarkt habe die Knappheit nur gedämpft. Auch Draghi habe in seinem Bericht gesagt, dass hohe Energiepreise zur größten Wettbewerbsfähigkeitslücke führten. Es bestehe daher hoher Handlungsbedarf.
Rolle stellte die BDI-Studie „Transformationspfade für Deutschland“ vor. Diese analysiere die Breite der Herausforderungen für den Standort und liefere Eckpunkte für eine neue industriepolitische Agenda. Die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie sei seit langem ein zentrales BDI-Thema. Der Industriestandort Deutschland falle in immer mehr Bereichen strukturell zurück. 880 Mrd. Klima-Mehrinvestitionen seien erforderlich, die Klimaregulatorik sei lückenhaft. Viele Probleme hingen mit dem politisch eng gesetzten Termin für die Dekarbonisierung zusammen. Es fehle die Möglichkeit für „Entdeckungsverfahren“. Zudem halte sich die Realität nicht immer an politische Pläne. Die Stromerzeugung würde sich gemäß aktuellen politischen Zielen infolge von Elektrifizierung mehr als verdoppeln. Allerdings sei die Stromnachfrage seit 10 Jahren stabil geblieben. Nicht klar sei auch, ob es die energieintensive Industrie im bestehenden Umfang noch geben werde. Global gebe es kein Level Playing Field für die CO2-Bepreisung. Fraglich sei auch, wie man Resilienz (z. B. gegenüber China) industriepolitisch richtig fassen könne.
Freitag – 07.03.2025
Professor Dr. Wolfgang KIRCHHOFF, Bundesgerichtshof, Karlsruhe:
Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Kartellrecht
Kirchhoff gab – wie in den vergangenen Jahren – einen Überblick über aktuelle Rechtsprechung des BGH, dieses Mal zum letzten Mal in seiner Funktion als Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof. Insbesondere ging er auf folgende Fälle ein: Kartellschadensersatz: Urt. v. 9.07.2024, KZR 98/20 – LKW-Kartell IV und Urt. v. 01.10.2024, KZR 60/23 – LKW-Kartell V.
Beschlüsse zu § 19a GWB (Beschl. v. 23.04.2024 – Amazon und Beschl. v. 20.02.2024 – Google Offenlegung).
Beschlüsse vom 17.09.2024, KRB 101/23 – (TGA-Kartell) und vom 03.12.2024 – KVR 8/24 (BKartA / Deutsche Lufthansa wg. Condor), der noch einmal die Thematik der unvollständigen Transparenz und der lückenhaften Dokumentation von Entscheidungen des Bundeskartellamts aufgriff („Besorgnis der Befangenheit gegen die Mitglieder der 9. Beschlussabteilung des Bundeskartellamts aufgrund verschiedener Fassungen eines Aktenvermerks“) – vgl. dazu auch FIW-Bericht vom 12.03.2025 – 58. FIW-Symposion – Andreas Mundt zu „Aktuellen Herausforderungen in der Wettbewerbspolitik“ – FIW Forschungsinstitut für Wirtschaftsverfassung.
Podium: Herausforderungen für die Fusionskontrolle – bedarf es weiterer Instrumente? Dr. Natalie HARSDORF, Bundeswettbewerbsbehörde, Wien
Professor Dr. Konrad OST, Bundeskartellamt, Bonn,
Mag. Christine DIETZ, Binder Grösswang Rechtsanwälte
Das Symposion schloss mit einer Diskussion zu aktuellen Entwicklungen und zur Zukunft der Fusionskontrolle. Harsdorf benannte die Fusionskontrolle als das wichtigste Instrument dafür, dass die Märkte offenblieben und für Innovation, sowie dafür, dass Unternehmen nicht noch größer werden, Österreich sei ein Land der KMU. Die Bundeswettbewerbsbehörde wolle in diesem Jahr die Umsetzung des Wettbewerbsmonitoring implementieren. In Österreich gebe es bestimmte Branchen, in denen Konzentrationsentwicklungen bestünden. Die Fusionskontrolle sei erst 2006 eingeführt worden. Seitdem habe es 6700 Fusionsanmeldungen gegeben. Es sei nur eine Fusion untersagt worden bei ca. 50 Rücknahmen von Fusionsanmeldungen. Es sei zu vielen Settlements, auch im Bußgeldbereich, gekommen. Die Erfahrungen mit der Transaktionswertschwelle in Österreich seien positiv, da sie mit der Digitalwirtschaft und dem Gesundheitsbereich zwei Bereiche erfasst hätte, in denen das
Innovationspotential sehr stark geschützt werden sollte. Österreich habe „seine Hausaufgaben“ schon gemacht, was Killer-Akquisitionen betreffe. Die Reichweite der Schwelle hänge jedoch von den Gerichtsentscheidungen ab. Call-In-Regelungen hätten hingegen viele Risiken, vor allem böten sie wenig Rechtssicherheit.
Ost berichtete ebenfalls über die von Österreich und Deutschland eingeführte Transaktionswertschwelle und forderte für die nationale Schwelle Änderungen. Insbesondere sei der erforderliche Inlandsbezug ein großes Thema. Von den 440 Prüfungen seien 30 Prozent auf den IT-Bereich entfallen, 24 Prozent auf den Pharmabereich und den Fahrzeugbau; es habe zwei 2. Phase-Fälle gegeben. In den meisten Fällen habe es sich um freiwillige Anmeldungen gehandelt. Nur in wenigen Fällen habe das Amt auf die Anmeldepflicht hingewiesen. Die Gesetzesbegründung nehme marginale Tätigkeiten beim Inlandsbezug aus. Die Unschärfe dieser unbestimmten Rechtsbegriffe habe sich insbesondere in den Fällen Microsoft /Open AI und Microsoft/Inflection gezeigt. In anderen Fällen (Meta/Kustomer) habe das OLG Düsseldorf zwischen einem „reifen“ und einem „unreifen“ Markt unterschieden, wobei ein „reifer“ Markt unter die zweite Inlandsumsatzschwelle und nicht unter die Transaktionswertschwelle falle. Das OLG lese in die Inlandstätigkeit das Tatbestandsmerkmal des „unreifen“ Marktes hinein. Ost plädierte für eine Call-In-Regelung innerhalb der Transaktionswertschwelle, um mehr Klarheit in diese Schwelle bringen zu bringen, was für die formelle Fusionskontrolle von großer Bedeutung sei.
Dietz berichtete über den Fall einer Geldbuße, die das Kartellobergericht (OGH) über die Rewe International AG verhängte wegen der verbotenen Durchführung eines Zusammenschlusses durch Inkraftsetzen eines langjährigen Pachtvertrages in einem Einkaufszentrum in Wels ohne vorherige Freigabe durch die BWB. Ihrer Meinung habe diese Entscheidung die Geldbußenpraxis in Österreich auf den Kopf gestellt. Die bisherige Praxis beliefe sich auf Geldbußen meist im Rahmen von Settlements und in einer Größenordnung im Rahmen 50T EUR und 150T EUR mit wenigen Ausnahmen (z. B. Facebook/Giphy). Die Geldbuße im Fall Rewe habe allerdings den Rahmen gesprengt. Nachdem das Kartellgericht wegen der nachträglichen Anmeldung überhaupt keine Geldbuße verhängt hatte, sanktionierte das OHG mit einer Geldbuße in Höhe von 70 Mio. EUR mit der „lapidaren“ Begründung, dass Geldbußen in einer Größenordnung verhängt werden müssten, wie sie auf Unionsebene und in den Mitgliedstaaten üblich seien. Das aber sei keine stichhaltige Begründung.