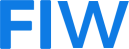FIW
51. FIW-Symposion
Kartellrecht
Das diesjährige Innsbrucker Symposion des FIW fand vom 14. Februar bis zum 16. Februar 2018 statt. Die Veranstaltung stand unter dem Leitthema „60 Jahre GWB und Europäisches Kartellrecht – Wie geht es weiter?“ und bot zum 51. Mal führenden Vertretern der Wirtschaft, Anwaltschaft, Verwaltung und Justiz ein Forum über Fragen der Wirtschaftsverfassung und der Wettbewerbspolitik. Zur Einstimmung auf die Tagung fand am Vorabend der Tagung ein Empfang auf Einladung des FIW sowie im Anschluss daran erstmals ein gemeinsames Eröffnungsdinner statt.
Donnerstag – 15.02.2018
Die Vorstandsvorsitzende des FIW, Dr. Angelika Westerwelle, begrüßte die Teilnehmer. Angesichts der schwierigen Regierungsbildung in Österreich und Deutschland habe man ein turbulentes Jahr hinter sich gebracht. Die Globalisierung wie der Protektionismus schritten beide weiter voran. Das Symposion richte sein Augenmerk zunächst darauf, was die letzten 60 Jahre seit Inkrafttreten des Wettbewerbsgesetzes gebracht hätten und wolle einen Ausblick auf die Zukunft wagen. Noch sei es ungewiss, was die Digitalisierung mit sich bringe und wie die in diesem Rahmen bestehenden und entstehenden Vermachtungstendenzen im Verhältnis zu Innovation zu bewerten wären. Fest stehe, dass die Grundlage für Freiheit und Innovation der Wettbewerb sei. Die Ansichten, wie dieser geschützt werden könne, divergierten bei weltweiter Betrachtung.
Im Anschluss übermittelte Frau Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer Grußworte und sprach ihren Dank aus, dass das Symposion Innsbruck treu geblieben sei. Sie übermittelte zudem Grüße des ehemaligen Landes-Hauptmanns von Tirol Van Staa. Die Frage, wie es dazu käme, dass die protektionistischen Kräfte aktuell Auftrieb hätten, sei wie die „Frage nach der Henne und dem Ei“. Fange man bei der Wirtschaft oder der Gesellschaft an? Oppitz-Plörer stellte fest, dass Wettbewerb nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft essentiell sei und Einfluss darauf habe, wie sich Welt entwickele. Angesichts der global zu beobachtenden tektonischen Verschiebungen in Gesellschaft und Politik müsse man den Verantwortungsträgern mitgeben, rechtzeitig die Stimme gegen Fehlentwicklungen zu erheben.
Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, Rechtsdurchsetzung in einer globalisierten und digitalisierten Welt
(vgl. separaten FIW-Bericht vom 23.02.2018)
Prof. Dr. Florian Schuhmacher, Universität Wien, Fusionskontrolle und Innovation (Zum Handout)
Schuhmacher wies in seinem Vortrag darauf hin, dass es kein eindeutiges Verständnis des Zusammenspiels von Fusionskontrolle und Innovation gebe. Das Verhältnis von Innovation und Wettbewerb sei als Grundlagenthema ökonomisch umstritten. Dies hindere jedoch die Praxis nicht, konkrete Fälle zu behandeln. Innovation sei im Wettbewerbsrecht in jedem Fall zu berücksichtigen, wie etwa bei der Prüfung der „erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs“. Dieser Befund werde durch neuere normative Entwicklungen verstärkt, etwa durch die in Deutschland neu eingeführte transaktionswertbezogene Aufgreifschwelle.
Aus ökonomischer Sicht sei dieser Befund weit weniger eindeutig. Wettbewerb könne man nicht statisch betrachten, sondern als Prozess. Dynamische Effizienz sei auch schwieriger fassbar als statische allokative und produktive Effizienz. Innovation sei ein Anknüpfungspunkt jenseits der einfachen Erklärungen der Chicago-School. Der Ökonom Schumpeter habe nicht das Ziel vollständigen Wettbewerbs vor Augen gehabt und auch nicht den Fall, dass Fusionen von Unternehmen zu Wettbewerbsproblemen führen würden. Nach seinem Wettbewerbsverständnis sei erhöhte Marktmacht etwas Positives gewesen, die zu mehr Innovation führen könne. Als Standardsichtweise habe sich allerdings die entgegengesetzte Strömung durchgesetzt, wonach Wettbewerb die treibende Kraft für Innovation sei. Wenn Wettbewerb wie bei Hayek als Prozess und als Entdeckungsverfahren verstanden werde, gelte dies speziell auch für neue Produkte und neue Dienstleistungen. Hier sei es nicht Aufgabe der Behörden, über das Marktergebnis zu entscheiden. Sie könnten und sollten nur den Prozess als solchen schützen. Auch nach den Leitlinien der EU-Rechtsprechung sei Wettbewerb nicht statisch im Sinne der Chicago-School zu verstehen, sondern Wettbewerbsprozesse müssten um ihrer selbst willen erhalten werden. Innovation werde neben Preis- und Mengeneffekten als gleichberechtigter Wettbewerbsparameter erfasst.
Bei der Fusionskontrolle, die sich mit ungewissen Abläufen in der Zukunft beschäftige, müsse stets eine Prognoseunsicherheit berücksichtigt werden. Schuhmacher schilderte schließlich den erreichten Nachprüfungs- und Analysestandard in der Fusionskontrollverordnung anhand einiger entschiedener EUGH-Fälle. Am kontroversesten sei der Fall Dow/DuPont zu beurteilen, bei dem nicht nur die Preiseffekte des Zusammenschlusses, sondern ein eigener Innovations- bzw. Technologiemarkt geprüft worden sei, der dem Produktmarkt vorgelagert sei. Die Entscheidung gehe über die Weitreiche der bisherigen Entscheidungen hinaus, indem Innovation bzw. die Fähigkeit zu Innovation in einem viel früheren Stadium berücksichtigt worden sei. Laut Schuhmacher mahne die theoretische Unsicherheit zur Vorsicht. Die Analyse müsse stets fallbezogen sein. Anhand von Fallgruppen ließe sich gegebenenfalls künftig ein Analysemodell entwickeln. In der Post-Chicago-Ära würden die Modelle zwar schwieriger und komplexer, damit könnten Marktmodelle jedoch zutreffender abgebildet werden.
Podiumsdiskussion – Automobil und Mobilität in der Zukunft
Dennis Kaben, LL.M., Legal Director, Google Germany
Silke Hossenfelder, Vorsitzende der 9. Beschlussabteilung, Bundeskartellamt (Zum Handout)
Dr. Philipp Haas, LL.M, Leiter IT-Recht, Robert Bosch GmbH (Zum Handout)
Zunächst stellte Haas Produkte und verschiedene Stadien der Konnektivität beim Connected Car vor. Er erklärte zudem, durch welche Einheiten man im Auto eine Konnektivität zur Plattform herstellen könne. Beispielhaft stellte er sog. Flottenmanagementprodukte, wie z. B. ein elektronisches Fahrtenbuch vor. Die Cloud könne freie Parklücken signalisieren, oder automated valet parking erlaube eine automatische Steuerung in das Parkhaus. Produkte benötigten Fahrzeugdaten. Derzeit gebe es kein absolutes Recht an Daten, so dass ein Zugriff auf Daten nur durch vertragliche Regelungen gewährleistet werden könne. Die Vertragsgestaltungen in digitalen Geschäftsmodellen seien allerdings äußerst komplex. Dem Zugriff Dritter könnten Sicherheitsbedenken entgegenstehen. Der Zugriff sei aber bereits jetzt im engen gesetzlichen Rahmen möglich.
Kaben erläuterte, dass die Digitalisierung des Autos Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle betreffe. „Mobility as a service“ stelle das Konzept und das Unternehmensziel von Automobilherstellern dar. Nach dem vernetzten Fahrzeug, d.h. einem mit dem Internet verbundenen Fahrzeug, sei der nächste Schritt das autonome Fahrzeug, das sich selbständig im Verkehr bewegt. Dies stehe im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Google sei beim vernetzten Fahrzeug bislang Zulieferer, etwa von Google Maps und anderer Geoprodukte. Jüngste Kooperationen zwischen Automobilherstellern und Zulieferern beträfen die erleichterte Handynutzung im Auto. Kaben ging kurz auch auf die neue Datenschutzgrundverordnung ein. Eine Einordnung der Rechtsnatur der Daten sei wichtig, die im Auto entstünden. Art. 20 DSGVO gebe den Betroffenen das Recht, über den Zugang zu Daten selbst zu bestimmen. Häufig gebe es im Fahrzeug keine Exklusivität des Zugangs zu Daten im Fahrzeug. So verfügten mehrere App-Anbieter häufig über die gleichen relevanten Daten, z. B. Standortdaten.
Hossenfelder berichtete, dass an verschiedenen Stellen Kooperationen entstünden, die daran arbeiteten, die Voraussetzungen von neuen Diensten rund um den künftigen automobilen Individualverkehr weiterzuentwickeln. Es gebe viele Gründe für Kooperationen. Derzeit gebe es niemanden, der alle Dienste aus einer Hand anböte. Die Produkte seien äußerst komplex und Forschung und Entwicklung so kostenintensiv, dass dies aus einer Hand nicht vorstellbar sei. Für die Frage einer Wettbewerbsbeschränkung sei die Fragestellung essentiell, ob es zu einer Abschottung gegenüber Dritten komme und ob die Wettbewerbsfreiheit in einem großen Maße beeinträchtigt sei. Es gelte das Prinzip der Selbstveranlagung. Das einzelne Unternehmen müsse beantworten, ob etwaige Freistellungsvoraussetzungen erfüllt seien, Effizienzgewinne entstünden, die Kooperation eine Verbesserung von Produktion oder des Vertriebs mit sich bringe, diese unerlässlich sei, und die Verbraucher angemessen an den Gewinnen beteiligt würden. Gleichfalls stelle sich die Frage nach einem etwaigen missbräuchlichen Verhalten. Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen könnten auch der Missbrauchsaufsicht unterliegen. Dies führe zu Folgefragen, z. B. ob andere Marktteilnehmer abhängig seien oder ob es sich um eine „essential facility“ handele. Hossenfelder nannte abschließend drei Beispiele für Kooperationen, zum einen die Gründung des Abgaszentrums der Automobilwirtschaft, zum anderen die Übernahme des Kartendienstleisters ‚Here‘ durch Automobilhersteller und Zulieferer und schließlich die Kooperation beim Internet-Bezahlverfahren Paydirekt.
In der anschließenden Podiumsdiskussion kam einerseits ein verhaltener Optimismus zum Tragen, wann autonomes Fahren komme. Man könne mit fünf bis zehn Jahren rechnen (Haas). Die technischen Gegebenheiten seien schon sehr weit, das System dürfe aber nicht durch unvorhersehbare Situationen durcheinandergeraten. Hier gelte eine bessere Vernetzung von Autos untereinander. Andererseits wurde auch eine pessimistische Sichtweise eingenommen, da autonomes Fahren in der Bevölkerung aufgrund ethischer Komponenten keine Akzeptanz habe (Kaben). Akzeptanz sei aber die Grundvoraussetzung für das Geschäftsmodell, das individuelle Freiheit im Sinne der Funktionsweise des Gesamtsystems beschneide. Es frage sich, mit welcher Fehlerrate dieses System akzeptiert werde und wie viele Rechenkapazitäten benötigt würden, um dieses System durchzusetzen. Außerdem setze das Setzen von technischen notwendigen Standards für ein solches System eine Zugangsproblematik voraus (Hossenfelder). Jede nicht notwendige Kooperation solle unterbleiben, wobei eine Einordnung in „notwendig“ und „nicht notwendig“ nicht immer trennscharf vorgenommen werden könne.
Prof. Achim Wambach, Vorsitzender der Monopolkommission, Präsident des Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) – Neue Herausforderungen für die Wettbewerbspolitik aus ökonomischer Sicht (Zum Handout)
Wambach stellte seinem Vortrag das Zitat von Müller-Armack der Freiburger Schule voran, dass „die soziale Marktwirtschaft (…) unter Wahrung der Marktfunktion sozialen Fortschritt [erreicht]“. Müller-Armack habe sieben konstituierende und vier regulierende Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft identifiziert: ein funktionierendes Preissystem, offene Märkte, ein Primat der Währungspolitik, Privateigentum, Haftung, eine Konstanz der Wirtschaftspolitik, Vertragsfreiheit sowie die Möglichkeit der Korrektur von Angebotsanomalien und externer Effekte, eine Monopolkontrolle und Einkommens-Politik. Als Charakteristika der sozialen Marktwirtschaft bezeichnete Wambach in dem Zusammenhang Privateigentum, Preise als zentrales Allokationselement, fairen Wettbewerb und das Prinzip der Sozialpartnerschaft.
Die digitale Marktwirtschaft „stelle die bisherigen Strukturen auf den Kopf“, so Wambach. Anstelle von Privateigentum gebe es die „sharing economy“, anstelle von Preisen Nullpreise oder Daten als Zahlungsmittel. Anstelle von fairem Wettbewerb gebe es Monopole, anstelle von Sozialpartnerschaften die Flexibilisierung und Auflösung der Arbeitsverhältnisse. Somit lösten sich die Charakteristika der sozialen Marktwirtschaft auf. Während der Anteil der 100 größten Unternehmen an der Wertschöpfung in den USA 1996 noch 33 Prozent betragen habe, betrage er 2013 bereits 46 Prozent (in Deutschland nur 16 Prozent). Diese Entwicklung wirtschaftlicher Macht sei immens und habe auch die Amerikaner aufgeschreckt. Dort werde ein Anstieg der Konzentration und der Margen beobachtet, von 20 auf 67 Prozent seit 1960 bis 2015. In Europa sei diese Entwicklung nicht zu beobachten.
Bei Margen brauche man keine Marktabgrenzung. In Deutschland sei keine Zunahme von Konzentration zu verzeichnen, aber nach der Wirtschaftskrise auch ein Anstieg der durchschnittlichen Margen, d. h. der unternehmensbezogenen Preisaufschläge zu verzeichnen. Als Konsequenz gehe der Produktivitätsanstieg zurück und werde insgesamt langsamer. Für dieses Produktivitätsparadox gebe es zwei Erklärungen: Zum einen bekomme der technologische Gewinner alles (the winner takes it all), und Behörden seien zu generös in der Anwendung der Fusionskontrolle. Die Fusionskontrolle sollte insbesondere in den USA effektiviert werden. Bei der Missbrauchsanalyse sei aus ökonomischer Sicht vieles noch nicht klar. Umso wichtiger sei es, dass demnächst Gerichtsentscheidungen anstünden. Wambach erhoffte sich aus den „Gutachterschlachten“ in den Missbrauchsfällen der Digitalwirtschaft einen Lerneffekt hinsichtlich der anzuwendenden „theorie of harm„. Er habe die Sorge, dass der Verbraucherschutz angesichts neuer Aufgaben des Bundeskartellamts in diesem Bereich künftig gegen den Wettbewerbsschutz ausgespielt werden könne. Sektoruntersuchungen halte er jedoch für ein gutes Instrument. Eine Regulierung von Plattformmärkten sei nicht die Lösung, sondern man müsse sich jeden Plattformmarkt spezifisch ansehen. Es gelte, alte Regeln zu hinterfragen, auch könnten Gründe für Regulierungen gänzlich entfallen. Dafür könnten neue Regulierungen notwendig werden. Neueintreter in den Markt brächten stets neue technologische Errungenschaften mit. Die Wirtschaft lebe vom Ausprobieren. Dies gelte auch für den Gesundheitssektor, auf den der Staat den meisten Einfluss habe und der am wenigsten digitalisiert sei.
Freitag – 16.02.2018
Prof. Dr. Juliane Kokott, Generalanwältin am Gerichtshof der Europäischen Union, Das Konzept der Fairness im EU-Wettbewerbsrecht
Kokott zufolge genießt der Kampf gegen Steuervermeidung und -hinterziehung weltweit hohe Priorität. In den Gründungsverträgen der Europäischen Gemeinschaften sei der Begriff „Fairness“ nur einmal beim Sport benutzt worden. Das Konzept eines fairen Verfahrens („fair trial“) sei jedoch einer der Grundpfeiler des Wettbewerbsverfahrens. Das Konzept der „Fairness“ bliebe jedoch vage. Es gehe darum, widerstreitende Interessen zu einem angemessenen Ausgleich zu bringen. Dies könne im Einzelfall relativ schwierig sein. Die Existenz des Wettbewerbsrechts sei bereits Ausdruck einer fairen Behandlung, weil dadurch ein „level playing field“ erst geschaffen werde nach dem Motto „gleiche Behandlung, gleiche Chancen“. Man müsse das Fairnesskonzept aus zwei Blickwinkeln betrachten. Wettbewerbsregeln sorgten auf der einen Seite für faire Geschäftspraktiken. Auf der anderen Seite müssten Wettbewerbsbehörden faire Regeln anwenden, um die Spielregeln durchzusetzen. Die verfahrensrechtlichen Aspekte der Fairness bestünden aus gefestigten Prinzipien, die eine faire Behandlung von Unternehmen ermöglichten. Das faire Verfahren sei durch Behörden und Gerichte sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene durchzusetzen. Die Verwaltungsverfahren seien unparteiisch und in angemessener Frist durchzuführen. Zum fairen Verfahren gehörten auch die Unparteilichkeit der Richter, eine angemessene Verfahrensdauer und eine Waffengleichheit der Parteien. Der EuGH gedenke, dies sicherzustellen. So habe der Gerichtshof schon überlange Verwaltungsverfahren festgestellt, den Durchsuchungsbefugnissen der Kommission Grenzen gezogen oder den Verstoß wegen des Rechts auf Akteneinsicht festgestellt. Das Konzept der Fairness beinhalte eine delikate Abwägung. Unternehmen dürften nicht gezwungen werden, ein Geständnis abzulegen, aber sie hätten andererseits auch kein absolutes Schweigerecht, sondern die Verpflichtung, mit der Kommission zusammenzuarbeiten.
Der materielle Aspekt der Fairness bedeute, dass sich alle Unternehmen an die Regeln des „fair play“ halten müssten. Das reibungslose Funktionieren des Miteinander könne nicht nur durch staatliche Intervention, sondern auch durch das Geschäftsgebaren von Unternehmen gestört werden. Deshalb dürften auch Fusionen den wirksamen Wettbewerb nicht beeinträchtigen. Es sei nie einfach, die Balance zwischen unverfälschten Wettbewerb und der Produktmaximierung der Unternehmen zu halten, so Kokott. Es sei anerkannt, dass Preiskartelle per se als wettbewerbswidrig anzusehen seien, ohne dass es eines Beweisaufwands bedürfe. Allerdings habe der Gerichtshof in seinem Urteil Carte Bancaire festgestellt, dass die Per-Se-Kategorien die Ausnahme bleiben müssten. Und unwiderlegliche Widerlegungen im Rahmen von 102 AEUV werde es nach dem Intel-Urteil voraussichtlich bei Treuerabatten nicht mehr geben. Der Gerichtshof habe festgestellt, dass Treuerabatte geeignet sein müssten um den Wettbewerb einzuschränken. Es sei zu früh, um abschließende Beurteilungen zu treffen, denn es sei nicht ausgeschlossen, dass es zu einem zweiten Rechtsmittelverfahren im Intel-Fall komme.
Prof. Dr. Wolfgang Kirchhoff, Richter am Bundesgerichtshof – Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Kartellrecht
Kirchhoff gab wieder einen Überblick über die zurückliegende aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Kartellrecht. Er beschränkte sich in seiner Darstellung – anders als auf seinen umfangreicheren Folien – auf wenige ausgesuchte Fälle. Zunächst berichtete er über den Beschluss vom 14. November 2017 im Verfahren Edeka/Tengelmann. Der BGH habe entschieden, dass Verhaltensweisen, die auf die Umsetzung eines Zusammenschlussvorhabens ausgerichtet sind, ohne den Zusammenschlusstatbestand zu verwirklichen, gegen das Vollzugsverbot verstoßen können, wenn sie geeignet sind, die Wirkungen des Zusammenschlusses zumindest teilweise vorwegzunehmen. Der BGH habe sich in dieser zuvor offenen Frage ausdrücklich einer in der Literatur vertretenen Auslegung von § 41 GWB angeschlossen, wonach auch solche Handlungen unter das Vollzugsverbot fallen könnten, die die Wirkungen des beabsichtigten Zusammenschlusses teilweise vorwegnähmen. Der BGH habe dies mit dem Zweck der präventiven Fusionskontrolle begründet, nämlich nachträglich schwer oder überhaupt nicht mehr zu korrigierende Verschlechterungen der strukturellen Wettbewerbsbedingungen durch anmeldepflichtige Zusammenschlüsse bis zur Feststellung ihrer Unbedenklichkeit zu verhindern. Die zusammenschlusswilligen Unternehmen hätten vor der Freigabeentscheidung grundsätzlich jegliches Verhalten zu unterlassen, das dazu führe, dass sie ihre Stellung als selbstständig agierende Marktsubjekte ganz oder teilweise verlören.
In der Sache sei es um die Durchführung eines Rahmenvertrages der beteiligten Unternehmen im Bereich der Warenbeschaffung und Zentralregulierung gegangen. Dieser habe Tengelmann berechtigt, Waren von Edeka zu günstigen Großhandelskonditionen zu beziehen, so dass der Bedarf weitgehend bei Edeka gedeckt worden wäre. Dadurch wäre Tengelmann nach Ansicht des BGH als eigenständiger Akteur auf dem Beschaffungsmarkt bereits vor Freigabe weggefallen. Edeka sollte darüber hinaus die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und das Forderungsausfallrisiko für Tengelmann übernehmen. Der BGH habe entschieden, dass diese Maßnahmen faktisch die beabsichtige Eingliederung von Tengelmann jedenfalls teilweise vorwegnehmen würden.
In Bezug auf das Anzapfverbot habe der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung vom 23. Januar 2018 („Hochzeitsrabatte“) einige Grundsatzfragen beim Anzapfverbot geklärt. Die Interessenlage habe folgende Rückschlüsse zugelassen: Es habe keine Abhängigkeit Edekas von den Sektherstellern bestanden. Zwar seien bestimmte Artikel für Edeka als Vollsortimenter unverzichtbar gewesen. Ein Scheitern der Verhandlungen hätte jedoch bei Edeka nur das Absatzinteresse an gewissen Kernprodukten aus dem Lieferantensortiment betroffen, bei den Sektherstellern wäre dagegen der gesamte Absatz mit Edeka kompensationslos fortgefallen. Hinsichtlich der Frage, ob Vorteile verlangt worden seien, habe der BGH festgestellt, dass eine Besserstellung des Normadressaten gegenüber dem bisherigen Zustand vorgelegen habe. Dies fehle bei Vergünstigungen, die objektiv aus Sicht des Forderungsadressaten im Synallagma von Leistung und Gegenleistung stünden. Auch müsse die Gegenleistung dem Adressaten ausreichend transparent und konkret angeboten worden sein. Eine Besserstellung gegenüber anderen Wettbewerbern sei hingegen nicht erforderlich. Andernfalls würde die Norm keinen Anwendungsbereich bei Nachfragemonopolisten eröffnen. Die Frage, ob eine Aufforderung zur Vorteilsgewährung vorliege, sei immer schon dann zu bejahen, wenn der Normadressat versucht, auf Lieferanten oder Abnehmer einzuwirken, um Vorteile zu erlangen, unabhängig davon, ob dies direkt bei den Verhandlungen geschieht. Eine sachliche Rechtfertigung fehle, wenn die Vorteile nicht leistungsgerecht seien. Hier greife eine entsprechende Vermutung ein, wenn zwischen Forderung und Grund oder angebotener Gegenleistung ein offensichtliches Missverhältnis besteht. Es komme für die Beurteilung auf eine Gesamtbetrachtung der vom Normadressaten verlangten Konditionen an; das Verhandlungsergebnis sei in der Regel unerheblich.
Florian Nöll, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Startups, Unternehmervortrag
Nöll führte aus, dass Start-Ups in der Regel innovative und auf schnelles Wachstum gegründete Unternehmen seien. Jedes Start-Up sei eine Gründung, aber nicht jede Gründung sei ein Start-Up. Gründer seien im Durchschnitt ca. 30 Jahre alt, zu 80 Prozent Akademiker und zu 70 Prozent Mitabsolventen. 80 Prozent der Start-Ups würden in der Digitalwirtschaft gegründet. Eine der wichtigsten Entwicklungen der letzten fünf Jahre sei das von deutschen Ingenieuren entwickelte elektrobetriebene Taxi gewesen. Start-Up Unternehmer seien im Grunde Familienunternehmer der ersten Generation mit einem Denken in „Iphone-Generationen“. Für diese Unternehmer sei eine Zusammenarbeit mit den etablierten Unternehmen wichtig, sowohl als Partner als auch als Kunden. Diese funktioniere allerdings noch nicht reibungslos. Es sei sogar ein Rückgang an Kooperationen zu vermerken. Am Ende eines Start-Ups stehe idealerweise der Börsengang (Exit). 82 Prozent der deutschen Start-Ups würden in die USA verkauft, während deutsche Traditionsunternehmen das Potential noch nicht erkannt hätten. Auch gebe es in Deutschland zu viele regulatorische Hürden, z. B. Compliance-Verpflichtungen. Auch das Insolvenzrecht schrecke ab. Selbst Mittelständler könnten nicht alle Anforderungen erfüllen. Für die weitere Entwicklung seien „Köpfe, Kapital und Regulierung“ entscheidend, so Nöll. Zu den „Köpfen“ führte er aus, dass schon in der Schule eine Anleitung zum unternehmerischen Handeln notwendig sei. 47 Prozent der Berliner Start-Ups kämen nicht aus Deutschland. Es werde dringend ein Fachkräftezuwanderungsgesetz gebraucht. Es fehle auch an „Kapital“. Bei einer Staatsquote von mehr als 50 Prozent stehe das System nicht auf eigenen Beinen. Die Anschlussfinanzierung werde in den USA doppelt so häufig geschafft. In den USA seien die Pensionskassen die primären Anlieger, die in der EU so stark reguliert seien, dass sie nicht investieren könnten. Es fehle generell Venture Capital. Nöll forderte zudem einen „Regulationscheck“. In der EU werde zuviel reguliert. Auch der Datenschutz habe einen negativen Einfluss auf innovative Geschäftsmodelle. Dies werde unter der Datenschutzgrundverordnung nicht besser werden. Auch sei man mit dem Breitbandausbau nicht vorangekommen. Eine digitale Verwaltung existiere nicht. Jungen Menschen sei trotzdem Mut zu machen, Unternehmen zu gründen. Es sollten die Chancen und nicht die Risiken in den Vordergrund gerückt werden. Dies sei die beste Voraussetzung zum Erhalt des Wohlstands. Viele Jobs würden verloren gehen, auf der anderen Seite aber auch neue geschaffen werden.
Competition Law and Legal Certainty post Brexit, Podiumsdiskussion
Dr. Philip Mardsen, Senior Director for Case Decission Groups, Competition and Markets Authority
Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamt und Vorsitzender des International Competition Network
Prof. Dr. Jacques Steenbergen, President, Belgian Competition Authority
Dr. Wolfgang Heckenberger, Senior Competition Adviser, Siemens AG
In der in englischer Sprache geführten Podiumsdiskussion sagte Mundt, dass er gern den Status quo beibehielte. Er ließ einige Fälle Revue passieren, die das Bundeskartellamt und die britische Wettbewerbsbehörde CMA (zuvor OFT) gemeinsam bearbeitet hätten (Online-Reisefälle, Amazon Market Place, Preisparitätsklausel). Es handele sich um eine gemeinsame Erfolgsgeschichte. Zukünftige Kooperationsmöglichkeiten könnten zwar auf der Ebene des ICN stattfinden. Der Austausch wäre aber nicht mit dem Austausch im ECN vergleichbar, da jener abstrakter sei, keine Rechtshilfe und keinen Austausch vertraulicher Informationen beinhalte. Auch ein bilaterales Abkommen biete nicht dieselben Möglichkeiten. Lediglich das Wettbewerbsabkommen zwischen der Schweiz und der EU enthalte die Möglichkeit eines Informationsaustauschs. Das Rechtshilfeabkommen mit den USA habe sechs Jahre gebraucht bis es abgeschlossen werden konnte. Dies sei kein Vorbild für die künftige Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich. Zwar biete Art. 50 b GWB schon jetzt die Voraussetzung eines Informationsaustauschs mit Drittbehörden. Diese Vorschrift sei jedoch noch nie angewandt worden. Dies könne sich jedoch mit Blick auf das Vereinigte Königreich, das ein ähnliches „Gateway“ in seinen Regelungen habe, in der Zukunft gegebenenfalls ändern.
In der Fusionskontrolle sei die Zusammenarbeit ohnehin in der Vergangenheit geringer und eingeschränkter gewesen als bei Art. 102 und Art. 102 AEUV. Es gebe schon jetzt Fälle mit unterschiedlichem Ausgang und verschiedenen Verpflichtungszusagen. Daher werde sich in dem Zusammenhang nicht so viel ändern, mutmaßte Mundt. Das CMA werde sich künftig mit größeren Zusammenschlüssen befassen. Die Fallanzahl in Deutschland könne ebenfalls steigen. Für Unternehmen werde eine weitere Fusionsanmeldung im Vereinigten Königreich zu erhöhten Bürden und Lasten führen. Bislang seien die materiellen Kriterien allerdings ähnlich. Das Wettbewerbsrecht gehöre zu den geringeren Problemfeldern beim Brexit, konstatierte Mundt. Er warb für eine Übergangsphase, die ebenfalls schwierig auszufüllen sein werde. In Form einer resignierenden Einsicht betonte Mundt: „Brexit is not complex, but impossible.„
Mardsen bemerkte, dass es für das CMA, das so eng mit den europäischen Wettbewerbsbehörden zusammengearbeitet habe, essentiell sei, diese Verbindung nicht abrechen zu lassen. Die Auswirkungen des Brexit auf die Aktivitäten des CMA hingen vom Ergebnis der Brexit-Verhandlungen mit der EU und den Bedingungen der künftigen Beziehung ab. Laut Mardsen habe das CMA keine festgelegte Position oder Vorlieben in dieser Hinsicht. Den Status quo zu erhalten, wäre das Beste. Da das britische Wettbewerbsrecht zu einem Großteil aus EU-Recht abgeleitet sei, werde vieles auch weiterhin parallel weiterlaufen. Falls es kein Verhandlungsergebnis geben sollte, würde die EU sofort ihre Zuständigkeiten verlieren. Dieses Ergebnis wäre in jeder Hinsicht defizitär. Es sei beispielsweise wichtig, Entscheidungen dahingehend zu treffen, wer nach dem Brexit für Entscheidungen zuständig sei, die aus der Zeit vor dem Brexit stammten. Genauso sei die Frage zu klären, welche Berufungsinstanzen für Übergangsfälle zuständig seien. Ohne Regelungen bestünde ein Risiko für Lücken bei der Kartellrechtsdurchsetzung. Im Moment des Brexit solle möglichst Rechtsklarheit herrschen.
Wie zuvor Mundt sprach sich Mardsen dafür aus, dass die nationalen Wettbewerbsbehörden auch zukünftig Informationen austauschen und auch zu Beweiszwecken verwenden dürfen sollten. Es sei wichtig, dass die Behörden auch weiterhin voneinander lernten. Es müsse spezifische Rechtsgrundlagen auf EU-Ebene und im Vereinigten Königreich geben, um auch künftig eine Zusammenarbeit zu ermöglichen. Das CMA werde künftig finanziell besser ausgestattet werden, da es viel mehr Fälle werde bearbeiten müssen. Der Fokus müsse darauf liegen, Divergenzen der Regime auch in der Zukunft möglichst zu vermeiden. Wahrscheinlich werde das CMA in der Zukunft mehr Leitlinien veröffentlichen müssen, da das Vereinigte Königreich nicht mehr durch EU-Recht gebunden sei.
Steenbergen konzentrierte sich auf Fragen der Vertikalbeziehungen. Während die digitale Revolution die Marktintegration erleichtere, habe sie auch vertikale Probleme und das Funktionieren des Binnenmarkts wieder an die Spitze der politischen Agenda der Wettbewerbspolitik rücken lassen. Steenbergen räumte allerdings ein, dass die Auswirkungen des Brexit auf Vertikalfragen kaum anders seien als auf andere kartellrechtliche Themen. Seiner Meinung nach gebe es zwei Grundprinzipien: Entweder behalte die Europäische Kommission ihre Zuständigkeit auch nach dem Brexit in Bezug auf Tatsachen, die vor dem Ausstieg lägen. Oder die Europäische Kommission und die nationalen Wettbewerbsbehörden seien nur für Wettbewerbsverstöße zuständig, die ihre Heimatmärkte und den Binnenmarkt beträfen. In jedem Fall könne die EU ihre Regeln weiterhin durchsetzen, z. B. in Bezug auf E-Commerce, wenn Vereinbarungen oder Praktiken die Märkte der EU-27 beeinflussten, allerdings nicht im bisherigen Maße, wenn sie auch den britischen Markt beeinflussten. Es werde Sache des britischen Gesetzgebers und der CMA sein, zu entscheiden, welche Regeln sie in Bezug auf das Verhalten der 27 EU-Akteure durchsetzen wollten, den britischen Markt betreffend. Nach Ansicht von Steenbergen werde der Brexit eine Reihe von Übergangsproblemen aufwerfen, die besser vor dem Austritt geregelt werden sollten. Der Austausch vertraulicher Informationen auf der Basis bilateraler Vereinbarungen sei indes nur sinnvoll, sofern Reziprozität gewährleistet sei.
Heckenbergers Kommentare basierten auf der Annahme eines harten Brexit. In dem Fall fiele das One-stop-shop-Prinzip in der Fusionskontrolle in Bezug auf das Vereinigte Königreich weg. Dies sei vor allem in komplexen Fällen problematisch. Künftig müssten die Unternehmen doppelte Anmeldungen vornehmen: In der EU und im Vereinigten Königreich. Das CMA sei „nicht zu beneiden“, so Heckenberger. Eine weitere Fusionskontrollanmeldung im Vereinigten Königreich vergrößere die bürokratischen Lasten und Kosten für Unternehmen. Die M&A-Praxis werde besonders unter dem Brexit leiden, prognostizierte Heckenberger. Im Kartellbereich sei die Situation ähnlich. Auch dort gehe der One-stop-shop-Effekt verloren. Künftig würden die Kartellbehörden parallel ermitteln und parallele Verfahren führen. Auch die Kronzeugenanträge würden an Komplexität zunehmen. Auch bei den Vertikalbeziehungen, die für In-House-Counsel höchst praxisrelevant seien, stellten sich Fragen, etwa ob die Vertikale Gruppenfreistellungsverordnung noch anwendbar sei und ob die Wettbewerbspolitik des Vereinigten Königreichs sich signifikant verändere oder gar vom US-Ansatz beeinflusst werden könne. Heckenberger hielt indes einen künftigen strikteren Kurs des Vereinigten Königkreichs nicht für wahrscheinlich.
Brigitte Zypries, Ministerin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, Rückblick und Ausblick
Zypries bemerkte anfangs, dass sich 2007 unter den wertvollsten Unternehmen nur ein einziges Unternehmen aus der Technologiebranche befunden habe: Microsoft. Derzeit gebe es auf der aktuellen Liste kein einziges Unternehmen mehr, das nicht aus dem Internet- und Technologiesektor komme. Die Internetwirtschaft habe die Welt verändert; Disruption sei in aller Munde, „nicht nur bei der SPD in Berlin“. Die Digitalisierung betreffe nicht nur
Unternehmen, sondern auch Gewerkschaften und die Politik, die die Rahmenbedingungen setzen müsse, damit Deutschland weiter an der Spitze bleibe. Auch das Kartellrecht müsse auf die einschneidenden Veränderungen reagieren. Es bedürfe eines Updates. Fraglich sei zum Beispiel, nach welchen Kriterien, die Marktmacht bestimmt werde, und wie die digitale Dividende allen zugutekommen könne. Der Missbrauch von Marktmacht müsse verhindert, die Datensouveränität verbessert werden. Diese Themen seien im Koalitionsvertrag festgehalten worden. Zypries ging in Folge noch näher auf die im Koalitionsvertrag verankerten Vereinbarungen für das Wettbewerbsrecht ein.
Das Internet sei für alle Bereiche des Lebens eine essentielle Grundlage geworden, wofür ein passender digitaler Ordnungsrahmen notwendig sei, der den Besonderheiten der digitalen Wirtschaft gerecht werde. Auf dem Weg dorthin sei auch schon einiges erreicht worden. Das Missbrauchsverbot gelte auch auf digitalen Märkten. Das Bundeskartellamt zeige in seinen aktuellen Verfahren, dass das Kartellrecht flexibel und innovativ auf neue Entwicklungen reagieren könne. Auch mit der GWB-Novelle habe man bereits auf die Besonderheiten von Plattformen und Netzwerken reagiert. Das deutsche GWB sei eines der modernsten Kartellgesetze der Welt.
Künstliche Intelligenz (KI) und Algorithmen hätten das Potential, das Leben noch mehr zu verändern. Für die Wettbewerbspolitik seien Algorithmen allerdings ein zweischneidiges Schwert. Sie verhülfen Verbrauchern zu einem besseren Überblick über Preise und führten zu leichteren Kaufentscheidungen. Auf der anderen Seite führten sie zu volatilen Preisen. So gebe es keine Reiseplattform, die nicht mit wechselnden Preisen arbeite. Der Verbraucher könne das Wettrüsten letztlich für sich entscheiden. Wenn KI genutzt werde, um Kartelle zu schmieden, sei dies jedoch problematisch. Unternehmen könnten nicht aus der Verantwortung entlassen werden, wenn Algorithmen automatisch handelten. Ein Missbrauch von Marktmacht könne auch dann nicht geduldet werden, wenn die Entscheidungen von einem Computer getroffen würden. Eine Regulierung in diesem Bereich sei jedoch schwierig. Hier seien Juristen und Ökonomen gleichermaßen gefragt. Nicht personenbezogene Daten sollten auch an Wettbewerber herausgegeben werden müssen. Zu klären sei auch, inwieweit weitere Erleichterungen für Unternehmenskooperationen vorgesehen werden müssten. Diese stünden nicht selten in einem Wettbewerb mit US-amerikanischen und chinesischen Unternehmen. Hier seien die Wettbewerbsbehörden gefragt, Konzepte zu entwickeln und Sachverstand bei sich einzurichten. Einen Chief Technologist müsse es auch beim Bundeskartellamt geben, um für Waffengleichheit mit den Unternehmen zu sorgen. Es sollten Leitlinien entwickelt werden, um Unternehmen bei der kartellrechtskonformen Programmierung und Nutzung von Algorithmen zu helfen.
Margrethe Vestager, Kommissarin für Wettbewerb, Perspectives from European Competition Policy
(vgl. separaten FIW-Bericht vom 01.03.2018)